Gebündelte Kompetenz
Seit rund einem Jahr gibt es die Wiener Kompetenzstelle Brandschutz (KSB). Irmgard Eder, Leiterin der KSB, gibt Einblicke in die tägliche Arbeit, bereits Erreichtes und einen Ausblick auf die Zukunft.

-

© Thinkstock -
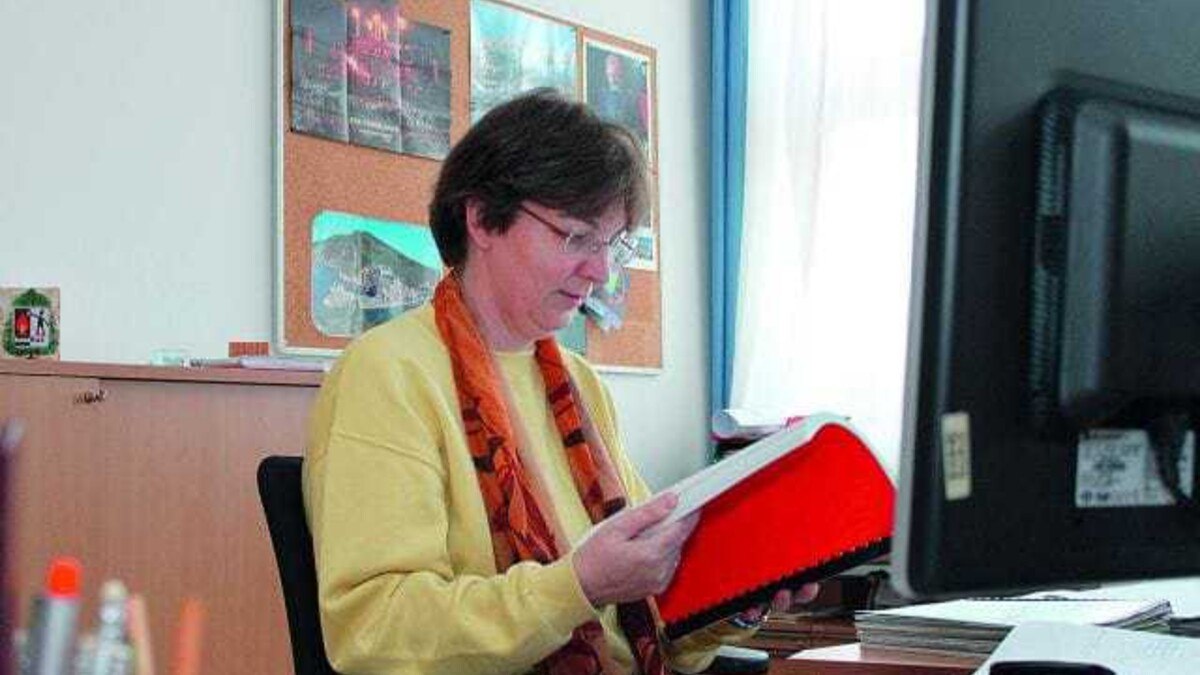
© Hauzenberger -

© Hauzenberger
Um nur noch eine zentrale Stelle für den Brandschutz in Wien zu haben, wurde vor rund einem Jahr die KSB gegründet. Die Leiterin Irmgard Eder zieht ein Resümee und gewährt einen Ein- und Ausblick.
Österreichische Bauzeitung: Was sind die grundsätzlichen Aufgaben der KSB?
Irmgard Eder: Wir haben drei Schwerpunkte in unserer Arbeit. Der erste sind grundsätzliche Angelegenheiten des Brandschutzes und zwar in allen vier Bereichen – baulich, anlagentechnisch, abwehrend und organisatorisch. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass wir eine Informationsstelle für Kunden in Behördenverfahren sind. Zusätzlich veröffentlichen wir Merkblätter, Richtlinien und Broschüren. Last, but no least stellen wir brandschutztechnische Sachverständige in definierten Verfahren – also in Bauverfahren, gewerbebehördlichen Verfahren, in Verfahren nach dem Veranstaltungsgesetz und in sanitätsbehördlichen Verfahren.
Was waren die Hauptthemen des Jahres 2013 für die KSB?
Einerseits haben wir in Zusammenarbeit mit der MA 36 und der MA 68 (MA für Veranstaltungswesen und der Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz Anm. d. Red.) monatlich anfallende Anfragen besprochen, die alle drei Abteilungen betreffen, und uns auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt. Ebenso haben wir in jeder Gebietsgruppe Kompetenzentwickler auf dem Gebiet des Brandschutzes geschaffen. Diese werden von uns geschult und kontrollieren die kleinen bis mittleren Projekte wie zum Beispiel Dachgeschoßausbauten.
Um genau zu definieren, unter welchen Voraussetzungen und Bestimmungen die KSB in Baugenehmigungsprozesse einzubinden ist, haben wir uns einem Qualitätsmanagementprozess unterzogen. Was aber vielleicht ein Jahrhundertereignis war: Wir haben es geschafft, einen brandschutztechnischen Auflagenkatalog zu erarbeiten, der sowohl für das Bauverfahren als auch für das gewerbetechnische Verfahren gilt. In Summe haben wir dafür zwei Jahre gebraucht, viel diskutiert und Synergien genutzt – schlussendlich ging es aber schnell. Dadurch haben wir nun im Bauverfahren, im Gewerbeverfahren und im sanitätsbehördlichen Verfahren die gleichen brandschutztechnischen Auflagen.
Gibt es bauliche Brandschutzrichtlinien, die gerade in Arbeit oder im Gespräch sind?
In den nächsten Tagen veröffentlichen wir eine Richtlinie über Brandschutz in Bildungseinrichtungen. Es gibt dazu ein drei Jahre altes Grundpapier der MA 34, das ein gut funktionierender Leitfaden war. Jedoch wurden Kindergärten, Horte, Volksbildungseinrichtungen und dergleichen nicht berücksichtigt. Da wir festgestellt haben, dass die brandschutztechnischen Unterschiede nicht wirklich groß sind, konnten wir das vorhandene Regelwerk auf alle Bildungseinrichtungen ausdehnen.
Dies ist als Ergänzung zu den bestehenden OIB-Richtlinien zu sehen. Insbesondere wurden auch Regelungen zur Evakuierung von Menschen mit Behinderungen in den Richtlinien verankert. Wir beschäftigen uns seit mehr als 20 Jahren damit, wie wir Personen barrierefrei in das Gebäude hineinbekommen, aber noch nicht wirklich damit, wie wir diese – unter anderem im Brandfall – aus dem Gebäude wieder herausbekommen.
Ist es gerade im Kampf für „leistbares Wohnen“ schwierig, Brandschutzrichtlinien aufrechtzuerhalten?
Natürlich kostet Brandschutz Geld, aber, etwas überspitzt ausgedrückt, solange Geld für eine Glasfassade da ist, steht die Diskussion über ein paar Brandschutztüren in keinem Verhältnis dazu. Aber ja, wir denken zurzeit darüber nach, wo Änderungen möglich sind. Die wesentliche Frage ist aber, wie weit der politische Wille, eine Reduktion des Sicherheitsniveaus in Kauf zu nehmen, geht. Im Moment scheint dieser teilweise vorhanden zu sein.
Bei welchen Punkten könnte man Ihrer Meinung nach über eine Reduktion nachdenken?
Wir sind gerade dabei, die OIB-Richtlinien zu überarbeiten. Eine fast beschlossene Sache ist, dass der Beginn des Fluchtweges im Wohnbau wieder die Wohnungseingangstüre sein wird. Auch im Fassadenbereich denken wir darüber nach, geringere Anforderungen zu stellen. So würden zum Beispiel französische Fenster bis zu einem gewissen Grad zulässig werden. Eine externe Evaluierung der OIB-Richtlinien hat auch ergeben, dass viele sich wünschen, mehr mit Holz bauen zu können.
Das fällt aber meiner Meinung nach nicht unter den Punkt der Baukostenreduktion. Wir haben zwar in Wien seit 2001 die Möglichkeit im mehrgeschoßigen Wohnbau – genauer gesagt bis zu vier Geschoßen – Holz zu verwenden; wir sind aber am Überlegen, das eine oder andere Geschoß noch dazuzugeben.
Gerade im Bereich der Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) wird viel über Brandschutz diskutiert. Wie sehen Sie die Situation?
Dafür gibt es seit 15 bis 20 Jahren klare Regelungen. Werden WDVS auf Basis von EPS mit einer Dicke von mehr als zehn Zentimeter verwendet, müssen über den Fenstern die sogenannten Brandschutzriegel ausgeführt werden. Wenn die entsprechenden Brandschutzriegel errichtet werden und entsprechend den Ausführungsrichtlinien gebaut werden, wird die Brandweiterleitung über die Fassade wirksam eingeschränkt, und es ist davon auszugehen, dass keine größeren Teile herabfallen werden, die Personen gefährden könnten. Sehr wohl davon zu unterscheiden ist der Umgang mit dem noch nicht fertigen WDVS auf der Baustelle.
Smart Citys sind in aller Munde. Bereiten Ihnen begrünte Fassadenkonzepte oder Fotovoltaikanlagen auf diesen schlaflose Nächte?
Das ist ganz unterschiedlich. Solange es um kleinere Gebäude geht, mache ich mir brandschutztechnisch wenig Sorgen. Gehen wir in den höheren Bereich, stellt sich für mich die Frage, wie gefährdet Einsatzkräfte sind, wenn es zu einem Brandfall kommt. Wo finden sie bei Fotovoltaikanlagen rasch die Möglichkeit, die Spannung abzuschalten, wie verhalten sich einzelne Elemente der Anlage im Brandfall? Ähnlich verhält es sich bei den Grünfassaden, wobei ich glaube, dass dabei nur die positiven Eigenschaften von beiden Seiten zusammengefügt werden müssen.
Wie sehen die nächsten Jahre der KSB aus?
Wir haben sicher ein paar große Projekte vor uns. Wir müssen uns mit Grünfassaden und Fotovoltaik an den Fassaden auseinandersetzen und wir wollen, ähnlich den Richtlinien für Bildungseinrichtungen, eine Richtlinie für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen schaffen. Genau wie wir die Richtlinien für das Dreigestirn der Bildungseinrichtungen – Neubau, Umbau/Zubau und Bestandssanierung – haben, soll es dies auch auf dem Gesundheits- und Sozialsektor geben. Wenn wir das hinbrächten, wäre das, glaube ich, etwas ganz Schönes und Tolles.
Dipl.-Ing. Irmgard Eder
Seit 2013 Leiterin der Kompetenzstelle Brandschutz (KSB) in der MA 37 – Baupolizei 2001 bis 2012 Leiterin des Dezernates Baulicher Brand-, Wärme- und Schallschutz in der MA 37
1989 Eintritt in den Magistrat der Stadt Wien als bautechnische Referentin
Vertreterin des Landes Wien im Sachverständigenbeirat Bautechnische Richtlinien im Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB) im Rahmen der Harmonisierung bautechnischer Vorschriften stellvertretende Vorsitzende des ON-K 006 (Brandschutz) im Austrian Standards Institute (ASI)




