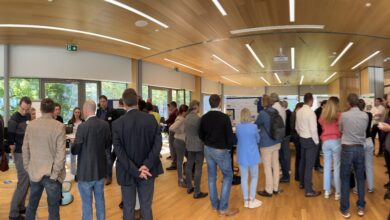Architektur kann kontern
Eisbedeckte Fensterscheiben und schneebedeckte Autos am Straßenrand gehörten vor einigen Jahrzehnten zu den üblichen Winterbildern in Wien. Heute sind sie zu einer Seltenheit geworden. Nicht nur die Winter sind wärmer geworden, sie werden auch gefolgt von sommerlicher Überhitzung.

von Betül Bretschneider
Obwohl die Vorstellung brütend heißer Sommertage gerade in der jetzigen Jahreszeit so manche Sehnsüchte auszulösen vermag, werden im Folgenden die Beeinträchtigungen des städtischen Lebens und der Umwelt durch an Hitzetagen entstehende Hitzeinseln (Urban Heat Islands – UHI) besprochen. Einfache Planungsregeln können diesen sehr wirksam entgegenwirken.
Die Zunahme der Jahresmitteltemperatur und der heißen Tage bzw. der „Tropennächte“ sowie der Rückgang von Eis- und Frosttagen sind die Konsequenzen der globalen Erwärmung, die in den Ballungsräumen durch den UHI-Effekt deutlich verstärkt werden, welcher aus der Stadtgröße, Bebauungsdichte und dem Versiegelungsgrad resultiert.1 Die Bebauungsstruktur spielt dabei eine große Rolle. Auch die Orientierung der Baukörper und die zum Einsatz kommenden Oberflächenmaterialien und -farben von Dächern, Fassaden, Höfen und Straßen sind wichtige Einflussfaktoren.
Nach aufeinanderfolgenden heißen Tagen und Nächten entstehen in dichtbebauten Stadtteilen sogenannte Hitzeinseln. Nach Messungen der Meteorologen weisen rund um städtisches Grün oder am Wasser gelegene Gebiete deutlich niedrigere Temperaturen auf. Der Temperaturunterschied zwischen locker bebautem Stadtrand und dicht bebautem Stadtzentrum erreicht an Hitzetagen bis zu sechs bis sieben Grad Celsius. Hitzeinseln entstehen, weil die kühlenden Grünflächen in der dichten Bebauung rar sind und ihre kühlende Wirkung durch natürliche Feuchtigkeit und Verdunstung daher kaum messbar vorhanden ist. Die Oberflächen der dichtbebauten Stadt speichern bei mehrere Tagen andauernder Hitze immer mehr Wärme, die bei ausbleibender nächtlicher Kühlung immer weiter ansteigt.
Der anfänglich als mediterranes Problem gesehene UHI-Effekt wurde angesichts der steigenden Zahl sommerlicher Hitzetage mittlerweile auch in den Städten der mitteleuropäischen Klimazone in den Mittelpunkt von Untersuchungen gerückt. So stellt etwa die Klimaforschung auch für Wien eine konstante und deutliche Erhöhung der Zahl von Hitzetagen fest.2 Diese Erhöhung bewirkt nicht nur eine erhebliche Steigerung des Kühlenergiebedarfs, der Emissionen und der Luftverschmutzung, sie reduziert auch den Lebenskomfort von Städtern, einschließlich der daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen. Durch die Vermehrung von Hitzeinseln werden zunehmend mehr Geräte und Anlagen (dadurch auch mehr Energie zur Kühlung) benötigt und eingesetzt. Ihre Verwendung verursacht eine weitere Erwärmung der sommerlichen Hitzeinseln in den dicht bebauten Stadtteilen.
Abbildung 1 (Seite 11) zeigt die Energiebedarf-Laständerung an extrem heißen Tagen im Netzgebiet eines österreichischen Elektrizitätsversorgungsunternehmens.
Berücksichtigung des Mikroklimas in der Planung
Die wichtigsten Einflussfaktoren zur Minderung der negativen Effekte von UHIs, die im Rahmen diverser internationaler wissenschaftlicher Forschungsarbeiten in den vergangenen Jahren wiederholt bestätigt wurden, zeigen Handlungswege auf, die einfach umsetzbar sein können.
Bebauungsstrukturen und Bebauungsdichte
Hier stellt sich die Frage, welchen Einfluss die gängigen Bebauungstypologien (samt offener Räume) sowohl der neuen Stadtentwicklungsgebiete als auch der gründerzeitlichen Stadtteile auf das Mikroklima hinsichtlich Wind-, Feuchtigkeits- und Wärmespeicherungsverhalten ausüben? Städtebauliche Typologien und Materialien beeinflussen unmittelbar die Entstehung und Stärke des UHI-Effekts: Die Zwischenräume beziehungsweise die offenen Räume der Stadt haben ein besonderes Gewicht, weil ihre Beschaffenheit, Proportionen, Nutzungen und Materialität eine große Rolle bei der Entstehung von UHIs spielen.
Nicht nur ein Grüngürtel sorgt im Sommer für großflächige Abkühlung, auch Windschneisen, die nicht durch Bebauungsstrukturen versperrt werden, übernehmen an besonders heißen Tagen eine kühlende Funktion. Dazu tragen die Bebauungsstrukturen wie bauliche Orientierung, Bauform, Höhe und Oberflächenmaterial ein Wesentliches bei. Reichen die üblichen Zentren der aktuellen „europäischen“ Masterpläne – bestehend aus Wasser- und Grünflächen – aus, um die mikroklimatischen Ziele für Lebenskomfort und Energiereduktion zu erreichen? Ist deren wiederbelebte Blockrandbebauung in ihrer baulichen Dichte und Höhe als Typologie zur Abkühlung geeignet?
Die Baukörper sollten unter Berücksichtigung von Wind- und Sonnenbewegungen modelliert werden. Dieser methodische Ansatz ergibt komplexere Bauformen als die gängige einfache Geometrie heutiger urbaner Morphologie in neu entstehenden Stadtteilen. Die Arbeit beginnt bei den Masterplänen und erstreckt sich bis zur baulichen Planung. Auch die räumliche Konfiguration in Bauten (zum Beispiel querdurchlüftbare Wohnungen oder Büros), Größe und Orientierung der Öffnungen sowie das Beschattungspotenzial spielen hierbei eine große Rolle.
Hauptstraße als Urban Canyon
Die Verkehrsstraßen machen ein Viertel der versiegelten Flächen in urbanen Gebieten aus. Die Forschungsergebnisse belegen international, dass starkbefahrene und dichtbeparkte Hauptverkehrsachsen, also „urban canyons“, sich in Hitzepole verwandeln. Insbesondere die Blechkarosserien der parkenden Autos, dunkel asphaltierte Gehsteige und Fahrbahnen ebenso wie die höhere und dichtere Bebauung an diesen Achsen sind die Hauptgründe dafür. Zudem sind laufende Motoren und Abgase hinzuzurechnen. Im Juli 2011 zeigten die Messungen der Klimaabteilung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf der Hohen Warte in Wien (Abb. 2, ZAMG), dass die Hauptverkehrsachsen auch in Wien vom UHI-Effekt deutlich mehr betroffen sind.
Einflüsse von Begrünungsmassnahmen
Grünflächen, die sowohl vertikal als auch horizontal zwischen und an den Baukörpern angelegt sind, können die extremen Temperaturen der Hitzeinseln maßgeblich mindern. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten wiederholt, dass Grünfassaden und -dächer sowie begrünte Straßen und Höfe zur Kühlung der Außenräume wesentlich beitragen.4 Zudem unterstützen diese eine effiziente Wassernutzung, reduzieren die Abwassermengen und dadurch auch den städtischen Infrastrukturaufwand. Sie verlangsamen die Verdunstung durch Schattenbildung, vermindern die Wärmespeicherung an den Oberflächen und binden die schädlichen Feinstaubpartikel. Hoftemperaturmessungen zeigen, dass Begrünung und Beschattung äußerst effektive Maßnahmen darstellen. Allerdings ist auch die Art und das Ausmaß der Begrünung ein wichtiger Faktor, weil beispielsweise eine nicht beschattete Wiese kaum einen Unterschied zu versiegelten Flächen zeigt. Außerdem braucht sie bis zu 50 Prozent mehr Wasser, wenn sie nicht beschattet bleibt.
Begrünungsmaßnahmen können überdies zu einer erheblichen Reduktion des Verbrauchs von fossilen Energieträgern führen, der die globale Erwärmung vorantreibt (siehe Abb. 3). Neben ihrem reduzierenden Einfluss auf den Kühlenergiebedarf senken sie auch die Zahl der motorisierten Verkehrsteilnehmer, da die begrünten öffentlichen Flächen, Fassaden und Höfe die Stadtbewohner dazu animieren, zu Fuß zu gehen („walkable streets“).
Diese Phänomene erhöhen auch die Lebensqualität und den Lebenskomfort der Stadtbewohner. Die ausreichende Verfügbarkeit von Grünflächen beziehungsweise begrünten Flächen wirkt auch der Stadtflucht von Stadtbewohnern entgegen, die außerhalb der Arbeitszeit die Stadt Richtung „Grün“ bzw. in Richtung „Land“ meist mit dem Pkw verlassen: noch ein Reduktionspotenzial für den Individualverkehr und dadurch weniger Verbrauch fossiler Energieträger.
Dachbegrünungen halten 40 bis 90 Prozent des Regenwassers zurück, lassen es verzögert abfließen und geben einen Teil über Verdunstung wieder ab. Dadurch entlasten sie die Kanalisation. Außerdem wirken sie temperaturausgleichend und filtern Staub und Schadstoffe aus der Luft. Gleichzeitig verbessern sie den Wärme- und Kälteschutz und mindern so den Energiebedarf (dichtes Graspolster: Wärmeleitzahl λ = 0,17 W/m²K, erdfeuchtes Substrat: λ = von 0,6 W/m²K) (Quelle: http://flachdachinitiative.ch, 2012).
Die positiven Einflüsse vertikaler Begrünungen an den Fassaden und von Bäumen auf die natürliche Kühlung von Bauten und die umgebenden Räume werden im Zuge der Planung aber oft außer Acht gelassen.
Die Bäume werfen nicht nur großflächige Schatten, sie filtern zudem die Luft und vermindern den Treibhauseffekt sowie den Verkehrslärm. Sie erhöhen die Lebensqualität und werten die Umgebung auf. Ein Baum versorgt durchschnittlich zehn Menschen pro Tag mit Sauerstoff.
Die notwendigen Anpassungen, die zu mikroklimatischen Verbesserungen führen sollen, berühren eine Reihe rechtlicher Bestimmungen und obliegen der behördlichen Handhabung. Obwohl das Einflusspotenzial der Architekten im Planungsprozess heute leider zunehmend eingeschränkt wird, gäbe es trotzdem eine große Notwendigkeit, die richtigen Ziele zu formulieren und das nötige wissenschaftliche Know-how zu verinnerlichen.
Allerdings definiert die internationale UHI-Forschung unterschiedliche Handlungswege: Während diese sich im US-amerikanischen Raum mit Produktentwicklung zur Oberflächenbehandlung beschäftigt, wird sie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2012 zum Herausgeber eines Handbuchs mit Handlungskonzepten, die grundsätzlich von der Stadtverwaltung getragen und implementiert werden können – zweifelsohne der wirksamere Weg.