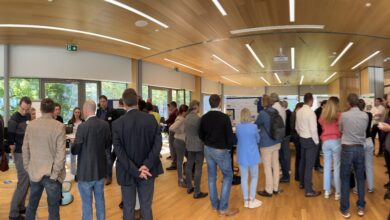Begrünung: “Ein Puzzlestein gegen sommerliche Überwärmung”
Die positiven Effekte von Bauwerksbegrünungen, vor allem in urbanen Gebieten, sind vielfältig. Für Planer*innen oder Ausführende ist es jedoch aktuell noch nicht möglich, diese Auswirkungen zu berechnen und zu belegen. Doch es wird intensiv an der Messbarkeit von Begrünungen gearbeitet. Rudolf Bintinger vom Institut für Bauen und Ökologie berichtet im Interview von den neuesten Forschungen und ersten Ergebnissen.

Welche Auswirkungen haben Bauwerksbegrünungen auf die Gebäude direkt und auf die Umgebung?
Bauwerksbegrünungen ermöglichen vor allem eine Erwärmung der Gebäude und der Umgebung zu reduzieren. Das beruht darauf, dass sie einerseits Sonnenlicht aufnehmen und damit beschatten und andererseits ihre Temperatur durch Transpiration, der Verdunstung durch Wasser, konstant halten können. Sie können also Wärme in nicht fühlbare Wärme, sogenannte latente Wärme, umwandeln. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Baumaterialien, die Sonnenenergie je nach Material lange speichern und lange verzögert abgeben, wie Asphalt, Beton oder Mauerwerk, und die stark reflektieren, wie etwa helle Fassadenfarben oder Flächenbeläge.
Für Bauherr*innen, Planer*innen oder Ausführende ist es aktuell nicht möglich, diese Auswirkungen zu berechnen und zu belegen. Es gibt aber bereits Forschungsprojekte zum Monitoring von Begrünungen. Können Sie uns dazu mehr erzählen?
Dazu wurden bereits im Forschungsprojekt “Glasgrün”, wo der Bericht kurz vor der Publikation steht, mehrere Kletterpflanzen auf deren Transmissivität, die Durchlässigkeit der Solarstrahlung, untersucht. Zwei weitere Projekte laufen aktuell noch: “Hedwig” beschäftigt sich mit der Wirksamkeit der Bauwerksbegrünungen im vorwiegend ungedämmten Bestand. Beim Projekt “Margret” erfolgen Untersuchungen auf einem messtechnisch sehr gut ausgestatteten Freiluftprüfstand im Neubaustandard und bei wechselbaren Fassadenbegrünungen. Die Ergebnisse dazu sind Ende 2025 zu erwarten und sollen weitere Kennwerte liefern.
Was ist das konkrete Ziel dieses Forschungsbereichs im IBO?
Begrünung ist ein Puzzlestein, um die sommerliche Überwärmung in Gebäuden und im Außenbereich hintanzuhalten. Für uns am IBO hat es zudem auch den besonderen Reiz interdisziplinär und mit lebendiger Materie arbeiten zu dürfen. Wir möchten helfen, Hürden auszuräumen, damit ein Teil der positiven Wirkungen von Bauwerksbegrünungen berücksichtigt werden kann, wie zum Beispiel durch die Integration in den Energieausweis und in Simulationsprogramme.
In welchen Bereichen besteht weiterer Forschungsbedarf?
Die hohe Vielfalt an verfügbaren Pflanzen, die für die Bauwerksbegrünung eingesetzt werden können, ist alleine schon eine Herausforderung. Sie unterscheiden sich in ihrem Wasserbedarf, jahreszeitlicher Blattbildung, Blattdichte, Wachstumsgeschwindigkeit, Dünge- und Wasserbedarf, um nur einige zu nennen. Das hat dann auch zur Folge, dass sich die für uns relevanten technischen Eigenschaften wie Verschattung, Lichtstreuung, Reflexion und Transpirationsleistung im Jahresverlauf ändern. Bei Dachbegrünungen kommt hinzu, dass auch hier eine Vielzahl an Substraten existiert und man zwischen bewässerten und unverwässerten Dächern unterscheiden muss. Es braucht also vor allem eine solide Datenbasis, die dann genutzt werden kann, um die bauphysikalischen Wirkungen standortbezogen abbilden zu können. Die Integration von Bauwerksbegrünungen in den Energieausweis und in Simulationsberechnungen ist derzeit auch noch kaum vorhanden.
Kann die Bauwerksbegrünung einen echten Stellenwert in der Gebäudeplanung bzw. in der Gebäudeoptimierung bekommen? Wie sieht es speziell beim Thema sommerliche Überwärmung aus?
Im Forschungsprojekt Glasgrün ergab sich, dass Bauwerksbegrünung das Wohlbefinden steigert, wenn es in dicht verbauten, vor allem urbanen Umgebungen mit wenig Grün zum Einsatz kommt. Die Anzahl der Architekturentwürfe in die Begrünungen integriert werden, nimmt meiner Wahrnehmung nach auch zu, weil sie ein zusätzliches Gestaltungselement, damit verbunden auch ein grünes Image, bietet.
Bei geschicktem Einsatz verringert Bauwerksbegrünung die sommerliche Überwärmung im Innenraum. Im Projekt Glasgrün haben wir festgestellt, dass Fassadenbegrünung eine echte Alternative zu einem außenliegenden Sonnenschutz sein kann. Bei einigen Kletterpflanzen beim Demoprojekt Glasgrün wurden in den Sommermonaten direkt hinter der Begrünung weniger als zehn Prozent der eintreffenden Solarstrahlung gemessen.
Welches Potenzial sehen Sie in der Dach- und in der noch viel mehr unterschätzten Fassadenbegrünung in Österreich?
Bauwerksbegrünungen haben im urbanen Bereich ein hohes Potenzial, generell das Wohlbefinden zu steigern. Mit innovativen Ansätzen wie einer Grauwassernutzung kann damit auch ohne zusätzlichen Wassereinsatz ein hoher Mehrwert geschaffen werden. Die Verwendung von Bauwerksbegrünungen ist abhängig von den Gegebenheiten wie etwa Platzbedarf, vor allem bei nachträglicher Einbindung. Im Bestand sind Objekte interessant, die nicht gedämmt werden können, oder wie beim Projekt Glasgrün Objekte mit hohem Glasflächenanteil. Hier kann auch ein Mehrwert durch zusätzliche Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten erzielt werden, wie beim Objekt in der Wiener Kreuzgasse, die auch Bestandteil des Forschungsprojekts Glasgrün ist. Natürlich tut man sich im Neubau leichter, da hat man dann mehr Optionen offen, ob es eine bodengebundene, troggebundene oder fassadenintegrierte Lösung sein soll, oder in welcher Form die Begrünung am Dach gestaltet werden soll hinsichtlich Substratstärke und Begrünungsintensität.
Fassadenbegrünung lässt sich sehr gut als gestalterisches Element einsetzen, wie man beispielsweise bei den Projekten von unseren Projektpartnern, den Architekturbüros Rataplan und Lichtblauwagner sehen kann. Die Planung und Pflege dürfen aber nicht außer Acht gelassen werden. Nur mit dem Hinhängen von ein paar Stahlseilen ist es nicht getan. Vor allem die Pflege ist für viele ein Hemmschuh. Es ist sinnvoll, in der Planung eine gute Zugänglichkeit zu den Bauwerksbegrünungen vorzusehen, um damit zum Beispiel einen aufwändigen Einsatz von Hubarbeitswägen zu vermeiden.

Zur Person
Rudolf Bintinger beschäftigt sich seit 2005 mit den Bereichen nachhaltiges Bauen, nachwachsende Rohstoffe und Energieeffizienz. Seit 2012 ist er in Beratungs- und Forschungsprojekten am IBO – Österreichischen Institut für Baubiologie und -ökologie in Wien tätig.