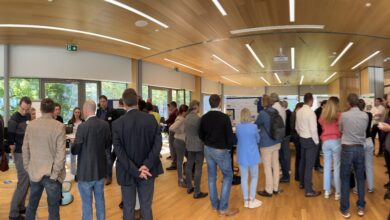Biomasse: Energiewende mit Holz
Der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz ist ein zentraler Schlüssel zur Energiewende. Tischler können durch einen Umstieg auf eine Biomasseheizung gleich mehrfach profitieren.



Mit der österreichischen Klima- und Energiestrategie 2030 hat man sich große Ziele gesteckt: So soll Österreich seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 36 Prozent gegenüber 2005 reduzieren – bisher wurden acht Prozent geschafft. Maßgeblich näher kommen will man diesem Ziel mit hundert Prozent Strom aus erneuerbarer Energie bis 2030. Bei Wärme sollen hundert Prozent bis 2050, dem langfristigen Ziel des Pariser Klimaabkommens, erreicht werden. Das bedeutet das komplette Aus für Kohle, Öl und fossiles Erdgas in der Wärmeerzeugung. Ihre Stelle nehmen dann erneuerbare Energien wie die Bioenergie ein – also Hackgut, Pellets, Scheitholz, Rinden, Biogas und Biotreibstoffe. „Biomasse wird in einer CO2-freien Zukunft der bedeutendste Energieträger sein“, sagt Christoph Pfemeter, Geschäftsführer des österreichischen Biomasse-Verbandes. Der Verein bildet in seiner Mitgliederstruktur alle mit Bioenergie befassten Gruppen ab.
Die Energie der Zukunft
Der Anteil erneuerbarer Energien im Gesamtenergiemix liegt derzeit bei rund 34 Prozent, bis 2030 soll er bei 45 bis 50 Prozent liegen, der Vertreter des Biomasseverbandes kann sich auch ambitionierte 60 Prozent vorstellen. „In jedem Energiewendeszenario spielt Biomasse die entscheidende Rolle. Sie ist unter den erneuerbaren Energien in Österreich die bedeutendste, gefolgt von der Wasserkraft, Windenergie und Photovoltaik. Im Gesamtvergleich liegt sie heute nach Öl und Erdgas an dritter Stelle unter den Energiequellen“, so Pfemeter. „Ob die Ziele erreicht werden, wird man allerdings erst in einigen Jahren sehen. Aber wir sind ob der Weichenstellungen, die jetzt gesetzt werden, sehr zuversichtlich.“
Eine dieser Weichen ist das sukzessive Verbot von Ölheizungen, die in einigen Bundesländern im Neubau gar nicht mehr installiert werden dürfen. Bestehende Anlagen können allerdings noch über Jahre laufen. Trotz des zumeist teuren Umstiegs ist ein solcher so bald wie möglich sinnvoll, um im Falle gesetzlicher Neuerungen nicht „von jetzt auf gleich“ eine neue Heizungsanlage installieren zu müssen.
Es hat sich viel getan
In Sachen technischer Entwicklungen hat sich im Bereich der Holzheizung in den letzten Jahren viel getan. Eines der wesentlich verbesserten Merkmale ist die automatische Steuerbarkeit, damit steigt die Bedienerfreundlichkeit. Im Gegenzug sinken der Brennstoffbedarf, die Emissionen, die Heizlasten und auch die Anlagenpreise. Die Systeme sind allgemein flexibler geworden und es werden z.B. Kombinationen eines Biomassekessels mit einer Wärmepumpe oder die Möglichkeit zum Verheizen von Scheitholz und Pellets angeboten. „Die Biomasseheizung ist vor allem das System für größere Bauten und sanierte Gebäude, da hier die Heizlasten höher sind. Im privaten Neubau sind durch die geringe benötigte Energiemenge Wärmepumpen im Vormarsch, hier wird Holz vor allem für eine Zusatzheizung z. B. in Form eines Kachelofens oder Kaminofens genützt“, führt Christoph Pfemeter aus.
Dazu noch ein interessantes Detail am Rande: Auch wenn die Kesselmenge auf ein Vielfaches steigt, wird die Brennstoffmenge durch moderne Heiztechnik, Dämmung und ähnliches konstant bleiben. Auch im Kraftwerksbereich wird der Mengenbedarf durch den sinkenden Energieverbrauch nicht explodieren.
Heizkosten im Fokus
Das Einser-Argument: Holz ist im Gegensatz zu Kohle, Öl und Erdgas ein nachwachsender Rohstoff, der regional in großer Menge zur Verfügung steht. Gegen Biomasseanlagen sprechen die hohen Investitionskosten, die – mit der Betonung auf noch – über den Preisen für fossile Heizsysteme liegen. Hier gilt es, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu schärfen. Genau da hakt der Heizkostenvergleich der Österreichischen Energieagentur (Austrian Energy Agency/AEA) ein. In den jährlichen Vollkostenvergleich werden zusätzlich zu den Energiekosten auch die Investitionen für die Anlagenbeschaffung, den Einbau und die Wartung miteinbezogen. Es wird nach unsanierten und thermisch sanierten Gebäuden sowie Neubauten unterschieden. Die Investitionskosten werden jährlich, die Marktpreise für die Energieträger monatlich aktualisiert.
Da als „Referenzgebäude“ ein für Österreich charakteristisches Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 118 Quadratmetern gewählt wurde, ist dieser Vergleich vor allem eine Orientierungshilfe für Private und bietet auch für Heizungs-Installateure interessante Informationen. Der Vollkostenvergleich bringt aber auch aufschlussreiche Erkenntnisse für Gewerbetreibende, vor allem in Sachen umweltfreundlicher Systeme. Denn von der AEA werden auch die durch die einzelnen Heizsysteme verursachten CO2-Emissionen gegenübergestellt. Und hier kann das Ergebnis nicht deutlicher sein: Die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizsysteme „schlagen“ alle anderen Varianten in Sachen Schadstoffausstoß um Längen: Der jährliche CO2-Ausstoß einer Stückholzheizung in sanierten Gebäuden liegt bei 107 Kilo, der einer Pelletsanlage bei 125. Bei einem Erdgas-Brennwertkessel liegt der Wert bei 2481 kg/Jahr, bei einer Öl-Brennwertheizung bei 4559. Bei unsanierten Gebäuden fällt der Vergleich noch krasser aus: Stückholz- und Pelletsanlagen liegen bei einer Emission von 226 bzw. 232, eine Öl-Brennwertheizung bei 9800 Kilo pro Jahr. Und auch eine Fördermöglichkeit wird in den Untersuchungen berücksichtigt: „Sieht man sich unseren Vergleich unter Berücksichtigung der Raus-aus-Öl-Förderung an, verlieren alle fossilen Systeme stark an Boden und alle anderen Biomasse- und Wärmepumpensysteme rutschen im Ranking nach vorne“, beschreibt Georg Trnka, Senior Expert und Projektverantwortlicher bei der Österreichischen Energieagentur, den positiven Effekt dieser unterstützenden Maßnahme (siehe Kasten).
Zusatznutzen für Tischler
Viele Tischlereien setzten aufgrund der Nähe zum Rohstoff Holz und wegen ihrer Lage im ländlichen Raum bzw. in waldreichen Gebieten schon lange auf den umweltfreundlichen Brennstoff. Hackschnitzel sind die naheliegende Form, da in solche Anlagen auch gehäckselte Reststoffe aus der Werkstatt eingebracht werden können. Bei der Verbrennung von Resten ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass es sich um unbehandeltes Holz handelt, das weder lackiert, gewachst, geölt oder ähnliches ist. Denn dann gilt Holz als Abfall und darf nicht mehr verbrannt werden. Die rechtlichen Details sind im Abfallwirtschaftsgesetz geregelt.
Einen weiteren Zusatznutzen kann die Brikettierung von Hobelspänen und Rinden bringen. Hier gibt es – je nach anfallender Menge an Spänen – die Option, eine eigene Produktionsanlage anzuschaffen und die Briketts selbst zu nutzen bzw. weiterzuverkaufen. Zudem kann sich ein Tischler mit einem kleinen Biomassekraftwerk als Nahwärmeversorger etablieren.
Gut investiert
Das Beispiel von Friedrich Breslmayer zeigt, wie so ein Umstieg mit Zusatznutzung in der Praxis funktionieren kann. „Wir wollten unser innerbetriebliches Angebot sinnvoll verwerten und Reststoffe umweltschonend verbrennen“, erklärt der Tischlermeister und Pensionswirt aus Gallspach in Oberösterreich die Gründe für den Umstieg auf eine Hackschnitzelheizung im Jahr 2012. Breslmayer begann circa fünf Jahre vor der definitiven Entscheidung damit, Erkundigungen über eine neue Heizanlage einzuholen. Zwar war man davor schon umweltfreundlich unterwegs und heizte die drei Mitarbeiter zählende Bau- und Möbeltischlerei, die Frühstückspension mit 28 Betten und das Wohnhaus mit Stückholz. Das war allerdings wenig komfortabel und die Wärmeerzeugung schlecht steuerbar. „Zudem hat Gallspach den Status eines Luftkurortes und wir waren angehalten, unsere Abbrandwerte zu verbessern“, so der Unternehmer.
Nach genauer Prüfung entschied man sich für die freistehende Variante: Das heißt, die 150 kW-starke Hackschnitzelheizung mit automatisch gesteuerter Verbrennung und einem 8000 Liter fassenden Pufferspeicher ist in einem externen Heizhaus untergebracht. Die Vorteile: Lärm und Staub belasten weder Mitarbeiter, noch Gäste und Hausbewohner, zudem ist das –als architektonischer Hingucker gestaltete – Gebäude ein eigener Brandabschnitt. Sollte etwas passieren, sind die anliegenden Häuser nicht betroffen.
Der Heizkessel schlug mit rund 50.000 Euro zu Buche, insgesamt investierte der Tischlermeister für das Bauwerk, die komplette Heizung- und Warmwasserbereitung inklusive Außenanlage 360.000 Euro. An Umweltförderung konnten 52.000 Euro lukriert werden. Mit der Anlage werden beide Betriebe plus das Privathaus mit einer Gesamtfläche von insgesamt rund 1900 Quadratmetern im Winter beheizt und ganzjährig das Warmwasser aufbereitet. Ebenso wird im Winter eine außenliegende Gehsteigheizung betrieben: Mit sehr geringem Energieaufwand erspart man sich damit das Salzen und Streuen und hält den Eingangsbereich des Gästehauses sauber. Eine mögliche Erweiterung ist bereits mitgeplant – das Heizhaus böte genügend Platz für einen zweiten Kessel, ein Aufrüsten auf ein Biomasse-Kleinkraftwerk wäre bei Bedarf möglich.
„Natürlich haben wir viel Geld in die Hand genommen, allerdings ist dieses auch sehr gut investiert. Denn gerade bei der Heizung muss man langfristig und vorausschauend denken, damit man auch für zukünftige Entwicklungen gerüstet ist“, sagt Friedrich Breslmayer. Zu den Vorteilen, von denen man jetzt profitiert, zählen Brennstoffsicherheit, Umweltfreundlichkeit und die Unabhängigkeit in Sachen Wärme- und Warmwassererzeugung.
Regionaler Brennstoff
Apropos Brennstoff: Zu zehn Prozent werden in Breslmayers Anlage unbehandelte Reststoffe der Tischlerei verfeuert, 90 Prozent der Hackschnitzel werden in der Umgebung angekauft. Die Brennstoffkosten für das ganze Objekt liegen im Jahr bei günstigen 4500 Euro. Zudem sind die Transportwege kurz, wodurch sich der ökologische Fußabdruck massiv verkleinert. Und nicht zuletzt reflektieren auch die Kunden auf das Umweltengagement ihres Gastgebers und Tischlers.