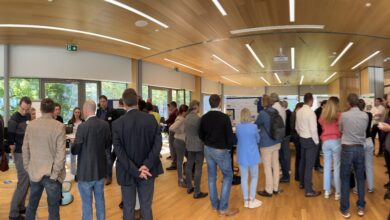Der Triumphbogen der Teilhaberei
Zu den konstituierenden Merkwürdigkeiten der Wiener Stadtanlage gehört die Autonomie des Fernbahnsystems vom Stadtbahn- und U-Bahn-System. Sie hat historische Ursachen. Und man muss kein großer Prophet sein, um vorauszusehen, dass diese Eigengesetzlichkeit weiterbestehen und sich sogar noch verstärken wird, weil die treibenden Kräfte auf beiden Seiten nicht zusammenarbeiten. Wie vor 150 Jahren stehen private Wirtschaftsinteressen und öffentliche Interessen in Konkurrenz.

Fernbahnanlagen wie die KaiserinElisabeth-Bahn (Westbahn, 1860 Wien — Linz — Salzburg) oder die Kaiser-Franz-Josefs-Bahn (1870 Wien — Eger) wurden von privaten Eisenbahngesellschaften errichtet, um ihrem Geschäftszweck, aber nicht um dem Personennahverkehr oder der Stadtentwicklung in Wien zu dienen. So mündeten die Fernbahnlinien in sieben isolierte Kopfbahnhöfe, wo der Grund billig und leicht zu erreichen war; erschlossen wurden Bereiche „vor der Stadt“, um den Güterverkehr abzuwickeln. Der Personenverkehr und die Aufwertung der Stadt im Bereich der Endbahnhöfe waren zu Beginn der Gründerzeit nicht entwurfsrelevant.
Hermann Czech argumentiert in seinem 2017 im Buch „Otto Wagner. Die Wiener Stadtbahn“ aktualisiert erschienenen, fast gleichnamigen Text über die Wechselwirkungen von Stadt und Stadtbahn. Er kommt zum städtebaulich und stadtplanerisch relevanten Schluss: „Ganz allgemein ist das Verhältnis von Abstraktion und Konkretheit im architektonisch-planerischen Diskurs gestört. Die aktuelle Erörterung von visueller Identität und der städtischen Umwelt hat sich nunmehr völlig auf das solitäre architektonische Werk zurückgezogen. Auf den Abstraktionsschritt zum planerischen Zusammenhang – wie immer dieser neu gefasst werden müsste – wird verzichtet. Ideologisch wurde er durch von der Sache abgehobene Philosopheme ersetzt; der reale Zusammenhang wird weitgehend dem Investor überlassen. Das Massenverkehrsnetz Wiens scheint da noch eine Ausnahme zu machen; gerade die Kongruenz mit der Investment-Topographie kommt aber vielfach nicht zustande.“
Düstere Verhältnisse
Der raumkonzeptive Gegensatz zwischen dem Massenverkehrsnetz und der „Investment-Topographie“ bedeutet einen erhellenden Zugang zu den jüngsten, düsteren Verhältnisse am Althangrund, wo bekanntlich große Teile der in die Jahre gekommenen Überbauung der Franz-Josefs-Bahn zur architektonischen Disposition stehen. Das heurige stadtplanerische Dilemma besteht im nie ausverhandelten Konflikt zwischen den Interessen der Anwohner im Stadtteil einerseits und den Interessen der Österreichischen Bundesbahn, samt den über dem Lichtraumprofil des Zugverkehrs agierenden Investoren, andererseits. In der Kaiser-Franz-Josefs-Bahn manifestierte sich zuerst privates Interesse: das Vorhaben von Johann Adolf Fürst zu Schwarzenberg, Steinkohle aus Pilsen nach Wien bringen zu lassen. Da passte es gut, in der Spittelau auf Graf-Althanschem Grund weites Land in ein Industriegebiet zu verwandeln. Erst später wurde die Bahnlinie verstaatlicht, und das Verkehrssystem nahm öffentlichen Charakter, mit Nutzen für den Personennahverkehr, an.
Als Puffer zur Stadt wurde 1872 am Althan-Platz (heute Julius-Tandler-Platz) nach dem Entwurf der Prager Architekten Ignaz Ullmann und Anton Barvitius der Bahnhof im Stil der Neorenaissance fertiggestellt. Mit drei überhöhten Geschoßen und zwei mächtigen als Uhrtürme ausgeführten Risaliten wirkte er mehr wie ein feudales Ringstraßenpalais, denn als Verkehrsbauwerk. Der Bau war Ausdruck einer Investition der Hochgründerzeit, aber kein Symbol der Fernbahn und schon gar keines des Massenverkehrs. Da er ein architektonisch entlehntes, privatisierendes Gesicht hatte, war dieser Bahnhof von Anfang an dysfunktional und wurde in der Zeit des Massenverkehrs geringgeschätzt, umgebaut und schließlich abgebrochen. Der erste Bahnhof hatte eine Lebensdauer von hundert Jahren, der zweite wirkt nach vierzig bereits abbruchreif.
Ökonomische Verwertung
Was danach kam und bis heute zu sehen ist, war der von der Bundesbahn ausgehende Versuch der Siebzigerjahre, den Raum über dem Gleis ökonomisch zu verwerten, Planungsrechte wurden verkauft, Claims abgesteckt. 1980 wurde der neue Bahnhof, eigentlich ein Bankgebäude mit versteckter Verkehrsfunktion, eröffnet. Entworfen wurde es von Karl Schwanzer (der sich von dem Projekt distanzierte) mit Franz Requat, Thomas Reinthaller und Harry Glück. Unweit entstand 1982 über dem Frachtenbahnhof die neue Wirtschaftsuniversität nach dem Plan von Kurt Hlawenicka. Nebenan folgten weitere Universitätsgebäude und das bauplastisch ominöse Polizeigebäude (heute Bundeskriminalamt). Mit der kommunalen Müllverbrennungsanlage Spittelau, die daherkommt wie die Sonntagsphantasie eines Schrebergartenbastlers, trägt dieses Ensemble heute das Label „Bermuda-Dreieck der Stadtplanung“, weil hier sichtbar ist, wie eine falsch interpretierte Bahninfrastruktur ganze Institutionen und einen ganzen Stadtteil marginalisieren kann.
Städtebauliches Desaster
Der Überbau wurde zum Hauptthema, die Bahnfunktion zur Nebensache. Die reale Stadt wurde der Bundesbahn und ihrem Geldbedarf überantwortet, den abstrakteren Zusammenhang der damit verbundenen Abwertung des Ortes wollte niemand sehen. Anstatt das Gleisband zu redimensionieren und das frei werdenden Bauland stadtdienlich zu verwerten, entschied man sich für die absurd aufwendige Stadtentwicklung „im ersten Stock“, die sich heute als sündteure Sackgasse und als städtebauliches Desaster darstellt. Der Rückbau wird erst in ferner Zukunft erfolgen können, nachdem erst kürzlich – zumindest aus der Perspektive der Lebensqualität im Alsergrund – die falschen Grundsatzentscheidungen getroffen wurden: kein Verzicht auf den Franz-Josefs-Bahnhof, keine Rücknahme des Gleisbandes nach Heiligenstadt, kein Abbruch der Bahnhofsüberbauung am Julius-Tandler-Platz, kein Ende der Barrierewirkung.
Obwohl das Massenverkehrsnetz der ÖBB in öffentlicher Hand ist, verhält es sich, zum Unterschied vom U-Bahn-Netz, nicht kongruent zum Phänomen Stadt. Die ÖBB agieren in Wien nicht anders als ein privater Investor. Das wurde am Hauptbahnhof deutlich, wo die hochbauliche Markierung des Bahnhofs als öffentlicher Ort des Übergangs unterlassen wurde. Der Mut zur Lücke wäre vielmehr am Althangrund nötig gewesen. So wird der Ort der Bedeutung am Hauptbahnhof architektonisch unterbesetzt und am Franz-Josefs-Bahnhof überbesetzt sein. Die „Investment-Topographie“, wie Czech das nennt, hat also kontingente Unstetigkeiten. Die Stadt Wien als Planungsinstanz hat sichtlich nicht die Macht, um für Stetigkeiten in der Stadtentwicklung zu sorgen.
Durchsetzungsproblem der Politik
Die aufsehenerregende „Stellungnahme der Bezirksvertretung Alsergrund vom 17. 1. 2018 zum Planentwurf Nr. 8233“, in der die städtebaulichen Rahmenbedingungen für den Althangrund abgesteckt werden, zeigt auf ein Durchsetzungsproblem in der Stadtplanungspolitik: „Es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, von öffentlichen Interessen abzurücken, um das Geschäftsrisiko von Privaten zu minimieren.“ Um die stadtplanungspolitische Niederlage des widerrufenen Widmungsverfahrens am Althangrund richtig einzuschätzen, ist darauf hinzuweisen: Die Parteien der Rathauskoalition verfügen im Bezirk Alsergrund über eine absolute Mehrheit. Seit der Wiener Gemeinderatswahl 2015 sind die vier stärksten Parteien der Bezirksvertretung Alsergrund die SPÖ (38,46 %), die Grünen (20,11 %), die FPÖ (18,60 %) und die ÖVP (11,52 %). Damit sind die Sozialdemokraten (39,59 %) und die Volkspartei (9,24 %) auf Stadtebene ähnlich stark wie im Bezirk, die Freiheitlichen (30,79 %) jedoch auf ganz Wien bezogen deutlich stärker, die Grünen (11,84 %) deutlich schwächer.
Fromme Wünsche
Der „Ideen- und Zielfindungsprozess Althangrund“, der 2010 begann, erbrachte, wie bei symbolischen Teilhaben nicht anders zu erwarten, auch nur „Generelle Empfehlungen und Zielvorstellungen“: „Der neue Stadtteil soll überschaubare Strukturen in hoher architektonischer Qualität aufweisen, die in offener, transparenter Weise eine angenehme Atmosphäre zum Wohnen, Arbeiten, Studieren und Verweilen in einem sinnvollen Mit- und Nebeneinander schaffen. Das Gebiet soll in gleicher Weise attraktiv für AnrainerInnen sowie NutzerInnen, als auch für Investoren sein, was durch nutzungsflexible Gebäude in nachhaltiger, energieeffizienter Bauweise erreicht werden soll. Eine Nutzungsmischung ist erwünscht (…) ‚Landmarks‘, einprägsame Baukörpersituierungen und -ausformungen sowie eine ansprechende Freiraumgestaltung sollen die Identität des Stadtteils stärken, Sichtachsen sollen Aus- und Einblicke gewähren. Eine angemessene Bebauungsstruktur – wobei auch ein einzelnes Hochhaus nicht ausgeschlossen ist – soll zusätzlichen Spielraum für ein höheres Ausmaß an Grün- und Freiflächen bieten.“
Wortspielkasten der Teilhaberei
Das sind fromme Wünsche aus dem Wortspielkasten der Teilhaberei, die ohne städtebaulichen Realismus in der Stadtentwicklung Utopie bleiben! So sind die infrastrukturellen und damit die städtebaulichen Kernfragen in den Verhandlungen mit den ÖBB ungelöst geblieben: Der bahntechnische Status quo bleibt, ein abgereifter Bahnverkehr wird im privatwirtschaftlichen Versteck gehalten. Ein Investor kaufte dann den Bestand und begann ihn zu entwickeln. Im März 2017 zeigte sich die Stadtplanungspolitik einer Auffassung mit dem Investor über die Entwicklungsziele für den Althangrund, einschließlich der Höhenentwicklung. Die nach dem zu still ausgehandelten städtebaulichen Regelwerk vorgesehene, aus dem Bestand hergeleitete Umlagerung des Bauvolumens könnte zu Hochhäusern bis 126 Meter Höhe (Referenz MVA Spittelau) führen, sagte man zu den Bürgern (ohne mit ihnen darüber diskutieren zu wollen) und schließlich auch den Teilnehmern an einem offenen Architekturwettbewerb. Erst zu diesem Zeitpunkt entschied sich die Bezirksvertretung Alsergrund, gewarnt durch den „Brand“ am Heumarkt, eine städtebauliche Position zu beziehen. Das hätte der Bezirk Alsergrund vor zehn Jahren aus eigener Initiative machen müssen, als man dem Bestand die Vergreisung schon ansah.
So wird bald der skelettierte Bankbau als schwarzer Triumphbogen der Teilhaberei über der FJ-Bahn stehen. Beim Aufstieg über die gigantischen Freitreppen wird man sich der urbanistischen Wahrheit von Hubert Klumpner anläßlich seines Vortrags 2016 bei der „Design Week Vienna“ erinnern: „Die Top-down-Konzepte der Städtebauer und die Bottom-up-Wunschbilder der Bürger sind für gelingende Stadtplanung zwingend zusammenzubringen.“