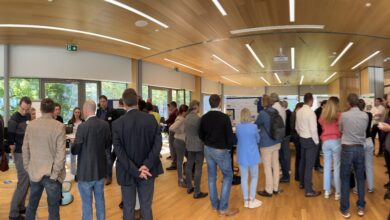Holzleichtbau statt Blechkiste
Trotz tendenziell sinkender Schülerzahlen steigt der Platzbedarf an Österreichs Schulen. Der vielfach in die Jahre gekommene Baubestand bedarf grundlegender räumlicher Anpassungen, um den erweiterten Bildungs- und Betreuungsangeboten von Ganztagsschule und Co gewachsen zu sein.


An vielen Schulen bedeutet das eine mehr oder weniger temporäre Auslagerung von Unterrichtsklassen in (Bau-)Container. Mit ihrem Zubau und der Sanierung der Volksschule Mannagettagasse in Wien-Grinzing zeigen Runser/Prantl architekten eine hochwertige Alternative zur unwirtlichen Blechkiste.
Für rund 220.000 Wiener Schüler heißt es nun nach dem Ende der Semesterferien wieder, eine Zeitlang die Schulbank zu drücken. Für immer mehr Kinder und Jugendliche bedeutet das auch zurück in den Container im Schul(hinter)hof. Denn als kostengünstige Alternative zu einer naturgemäß teureren baulichen Erweiterung erfreuen sich die sogenannten Containerklassen steigender Beliebtheit – zumindest aufseiten der Schulbehörde. Ganz anders sieht das bei Lehrern, Eltern und Schülern aus, die die Gebäude vorübergehenden Bestands – so die bildungsbausprachliche Bezeichnung – weitaus weniger zu schätzen wissen. Ebenso wenig wie zahlreiche Anrainer, die sich auch nach mittlerweile über vier Jahrzehnten Containerklassen in Wien noch immer nicht an den Anblick gewöhnen wollen.
Der Schulbau steckt diesbezüglich in einem gehörigen Dilemma. Einerseits mangelt es an allen Ecken und Enden immer wieder an Geld, um dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, oder einfach auch nur, um den Gebäudestandard den erhöhten Anforderungen der Bauordnungen und Schulbaunormen anzupassen. Was in der Regel auch einen wesentlich höheren Platzbedarf mit sich bringt – wie sich am Beispiel der Schülergarderoben deutlich zeigen lässt: Waren Mantel, Schuhe, Schal und Haube in der Vergangenheit oft entlang der Gänge aufgefädelt, braucht man hierfür heute aufgrund feuerpolizeilicher Bestimmungen eigene, von den Verkehrswegen abgeschottete Garderobenräume.
Das kostet Platz. Platz, den man aber ohnehin auch schon für neue pädagogische Konzepte wie Kleinklassen, Lerngruppen u. dgl. brauchen würde. Hinzu kommen Ganztagsschule und Nachmittagsbetreuung, und schon ist selbst in Schulen mit sinkenden Schülerzahlen der Platzmangel perfekt. Trotzdem scheut die Schulbehörde (in Wien die MA 56 – Wiener Schulen) davor zurück, in Erweiterungen und Zubauten zu investieren. Denn dem erhöhten Platzbedarf steht eine rückläufige Geburtenrate gegenüber – wer wagt schon vorauszusagen, wie viele der Klassen, die jetzt in Containern untergebracht sind, in zehn oder 20 Jahren überhaupt noch gebraucht werden. Spätestens dann sollte ja auch die Schul-und Bildungsreform über die Bühne gegangen sein, damit man weiß, wie Schule in Zukunft überhaupt aussehen soll und ob das derzeitige Raumangebot in den Bildungsbauten dann überhaupt noch den geltenden Anforderungen entspricht. Fragen über Fragen, die es im Schulbau zu klären gibt, während viele Kinder und Jugendliche ihren Schulalltag im Container fristen. Weit mehr als 200 solcher Containerklassen gibt es derzeit alleine nur in der Bundeshauptstadt – Tendenz weiter steigend.
Neue Wege im temporären Schulbau
Doch es geht auch anders, wie das Wiener Architektenteam Christa Prantl und Alexander Runser bei ihrem jüngsten Projekt – der Bestandssanierung und dem Zubau zur Volksschule in der Grinzinger Mannagettagasse – eindrucksvoll unter Beweis stellt. Mit einem deutlichen Mehr an architektonischer, räumlicher und bauphysikalischer Qualität, und das auch noch ohne explodierenden Kostenrahmen. Fast zu schön, um temporär zu sein, denn beim aktuellen Zubau handelt es sich aus baurechtlicher Sicht tatsächlich um ein Gebäude vorübergehenden Bestands. Von seiner Konstruktions- und Bauart her lässt sich der hochwertige Holzbau relativ einfach in seine Einzelteile zerlegen und anderweitig wiederverwenden. Die Stadt Wien beschreitet damit einen erfolgversprechenden Weg, Containerklassen durch Holzleichtbauweise zu ersetzen. Ein Konzept, das in Wien insgesamt erst zweimal zum Einsatz gekommen ist und nach ersten positiven Erfahrungen hoffentlich weiter Schule im Schulbau machen wird.
Denkmalgeschützter Bestand
Die Bauarbeiten am Zubau in der Mannagettagasse wurden rechtzeitig vor den Semesterferien abgeschlossen, sodass die Schüler mit Beginn des Sommersemesters ihre neuen Klassenräume besiedeln konnten. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für das Bestandsgebäude befinden sich derzeit in der Detailplanung und sollen, wenn alles nach Plan verläuft, in den beiden nächsten Sommerferien durchgeführt werden. Trotz der vergleichsweise kleinen Planungs- und Bauaufgabe sah sich Runser/Prantl architekten mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Der kompakte, zweigeschoßige Altbestand aus der Gründerzeit wurde von niemand Geringerem als Heinrich von Ferstel, dem Architekten der Wiener Votivkirche, geplant und in den Jahren 1871–1872 errichtet. Was für Runser und Prantl bedeutet, dass jeder bauliche Eingriff in das denkmalgeschützte Gebäude, die Verbindung von Alt- und Neubau wie auch schon zuvor die Lage der beiden Baukörper zueinander mit den Denkmalschützern abgestimmt und diskutiert werden müssen. Darüber hinaus entspricht der Bestand in weiten Bereichen nicht mehr den hohen Anforderungen eines zeitgemäßen Schulbaus – vor allem was den Brandschutz, sicherheitstechnische Belange oder die Barrierefreiheit angeht.
Wesentliche Kritikpunkte, die im Rahmen von Sanierung und Umbau natürlich gelöst werden müssen. Wenn möglich so, dass sie das historische Erscheinungsbild nicht stören, was vor allem in Bezug auf die Barrierefreiheit nicht ganz einfach zu erfüllen ist. Straßenseitig ist das Schulgebäude nur über eine Treppe zu betreten, ebenso trennt auch eine Treppenanlage Erdgeschoß und Schulhof. Und der Luftraum der Treppenspindel ist zu klein, um einen rollstuhlgerechten Lift einzubauen.
Die Lösung für dieses Problem bringt der neue Zubau. Seine Situierung und Höhenlage hat Runser/Prantl so gewählt, dass nach Abschluss der Sanierungsarbeiten zwischen Alt- und Neubau ein niveaumäßig an das Erdgeschoß des Bestandes angepasster Schul- und Spielhof entsteht. Dieser gewährleistet die barrierefreie Erschließung der beiden Gebäude. Im Endausbau soll eine verglaste Brücke die beiden Schulteile im ersten Obergeschoß miteinander verbinden. Dieser gläserne Verbindungsgang erleichtert nicht nur die interne Organisation (weil Kinder nicht mehr über den Hof von einem Gebäude ins andere wechseln müssen), sondern ermöglicht im Bedarfsfall auch die Nutzung des Treppenlifts im Neubau. Soweit die Planung. Vorläufig verbindet nur ein aufstockbares Flugdach beide Baukörper. Und die endgültige Entscheidung in puncto Brücke ist aufseiten von Wiener Schulen noch nicht gefallen. Die Alternative wäre ein außenliegender Lift am Ferstelbau, was nicht nur den Architekten, sondern auch den Denkmalschützern ein Dorn im gestalterischen Auge wäre.
Leichter Zubau
Trotz zahlreicher, einschlägiger Wettbewerbserfahrungen ist die Volksschule in der Mannagettagasse der erste Schulbau, den Runser/Prantl realisieren konnten. Während im Altbau erhöhte Anforderungen und Auflagen infolge des Denkmalschutzes gelten, so waren es beim Zubau die Vorgaben aus der Widmung „Gebäude vorübergehenden Bestandes”, die den Architekten mitunter das Leben schwer machten. So sahen sich die erfahrenen Architekten bei ihrem ersten Schulbau mit einem Konvolut von Normen, Vorschriften, zusätzlichen Auflagen und mancherlei Einschränkungen infolge der temporären Nutzung konfrontiert, die es geschickt in nutzbare Flächen umzusetzen galt. Beispielsweise sind bei der Errichtung von mobilen Klassen keine Pausenräume für Schüler vorgesehen. Mit einigem Verhandlungsgeschick konnten die Architekten aber zumindest den Raum unter der Treppe für die Kinder freihalten. Dafür mussten der Serverraum und das Lager für Putzgeräte unter der Treppe weg in ein eigenes „Kammerl” neben den Sanitärzellen argumentiert werden.
„Sowohl in der denkmalgeschützten Sanierung als auch im mit Auflagen und Vorschriften gespickten Schulneubau geht es letzten Endes immer auch darum, sich seine gestalterischen Freiräume zu schaffen”, erklärt Alexander Runser pragmatisch. „Es erfordert mitunter aber auch einen erheblichen Diskussionsbedarf und viel Überzeugungsarbeit, will man das Maximum für die späteren Nutzer herausholen”, ergänzt Christa Prantl und hat auch gleich das entsprechende Beispiel parat. So war in der ursprünglichen Planung des Zubaus eine lichte Raumhöhe wie im Bestand von annähernd vier Metern vorgesehen, was sich nicht nur positiv auf die Ausleuchtung auswirkt, sondern den Klassenzimmern auch ein großzügiges Raumluftvolumen bereitstellt.
So war es im Konzept vorgesehen und auch im Vorentwurf sowie im Entwurf. Doch dann machte die MA 56 – Wiener Schulbau als Bauherr einen Strich durch die Planung: Von den Bestimmungen für Containerklassen her kommend, ist für provisorische Klassen eine Raumhöhe von exakt zweieinhalb Metern vorgesehen. Nach vielem Hin-und-her-Gerechne ergaben sich Mehrkosten von weniger als zwei Prozent der gesamten Bausumme, und so einigte man sich schließlich auf eine Raumhöhe von drei Metern. Die Architekten sehen es heute sogar positiv: „Durch die Verringerung der Raumhöhen im Neubau wird die geplante Brücke die beiden Bauteile nun in einem leichten Gefälle verbinden, was dem gesamten Ensemble sogar eine zusätzliche Dynamik verleiht”, so Architekt Runser.
Die Situierung des langgestreckten Holzbauriegels auf dem Grundstück ist so gewählt, dass die vorhandenen Gartenflächen und Freiräume in bestmöglich nutzbarer Form erhalten bleiben und der Freiraum als wichtiges Kriterium einer Ganztagsschule aufgewertet wird. Die Konstruktion des Zubaus und der Verbindungsbrücke besteht aus Brettschichtholz mit horizontaler Brettlage. Als vorgefertigte Elementbauteile wurden die einzelnen Wand- und Deckenmodule – teilweise mit einer Länge von bis zu 17 Metern – geschoßweise auf eine Fundamentplatte montiert. Am 6. August starteten die Bauarbeiten, und nicht ganz drei Tage später, am Nachmittag des 9. August, waren die Rohbauarbeiten bereits abgeschlossen. Sämtliche Installationen verlaufen in eigenen Installationsschächten und werden hinter den Vorsatzschalen, im Bodenaufbau bzw. über die abgehängten Decken im Gebäude verteilt. Erforderliche Elektroinstallationen entlang der tragenden Außenwände wurden auf der Außenseite in die Brettschichtholzelemente gefräst und durchgebohrt. Im Innenbereich bleibt die Holzoberfläche durchgehend sichtbar und wurde lediglich weiß lasiert.
Die äußere Hülle bildet eine hinterlüftete Fassade mit 20 Zentimeter Wärmedämmung und durchgefärbten anthrazitfarbenen Eternitplatten auf einer Konterlattung. Der Neubau ist im Niedrigstenergiestandard ausgeführt und ermöglicht sogar den nachträglichen Einbau einer kontrollierten Raumlüftung. Leicht wieder demontierbar und in seine unterschiedlichen Bauteile und Baustoffe wieder zerlegbar, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit der technischen Nachrüstung bietend, ist das Gebäude auf alles vorbereitet. Auf einen „Umzug” samt Nachnutzung ebenso wie für ein beständiges Dasein als dauerhaftes Provisorium.