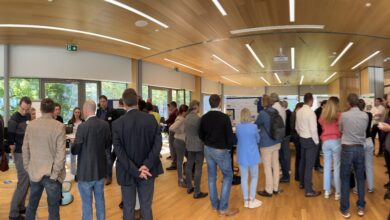Waun da Heagott net wü …
Die Wohnbauförderung in ihrer heutigen Form gilt Raumplanern längst als Triebfeder der Zersiedlung. Ökologen stufen sie als umweltkontraproduktiv ein, für Sozialexperten mangelt es ihr an sozialer Treffsicherheit, Ökonomen halten sie für eine ineffiziente Gießkannenförderung, und für Föderalismuskritiker ist sie ein Zeichen des fortschreitenden bundespolitischen Machtverlusts. Trotzdem bleibt alles so, wie es ist. Über ein Paradebeispiel für Misswirtschaft, Ignoranz und Reformverweigerung in Österreichs Politik – leider nicht das einzige.



von Reinhard Seiß
Im Zuge der immerwährenden österreichischen Bildungsdebatte gab es vor nicht allzu langer Zeit doch tatsächlich die Forderung der Landeshauptleute, neben den Landesschulinspektoren, Bezirksschulinspektoren, Berufsschuldirektoren, Hauptschuldirektoren, Volksschuldirektoren und allen möglichen sonstigen nach dem Proporzsystem ernannten Schulamtsinhabern künftig auch noch die Direktoren der Bundesschulen benennen zu dürfen. Mag sein, dass sich uns Laien der bildungspolitische Sinn dieses Vorstoßes nicht zur Gänze erschließt, doch verströmt er den Hautgout des inhaltlich völlig haltlosen Strebens nach noch größerer Entscheidungsgewalt über Dinge, die andere bezahlen müssen – und steht damit symptomatisch für das Politikverständnis der neun Landesregenten. Keiner von ihnen brauchte sich je vor Wahlen für eine Steuererhöhung rechtfertigen. Diese lästige Aufgabe übernimmt hierzulande der Bund, der seine Einnahmen im Zuge des Finanzausgleichs an die Länder verteilt – unverständlicherweise allerdings, ohne an diese Gelder auch nur irgendwelche qualitative Bedingungen zu knüpfen. Im Gegenteil: Längst stellen die Geldempfänger die Bedingungen.
Mittelstandsförderung
So geschehen auch bei der Wohnbauförderung. So gut wie jeder Österreicher kennt sie vom monatlichen Lohnzettel: Ein Prozent des Bruttolohns, je zur Hälfte aufgeteilt auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wird vom Fiskus als Wohnbauförderungsbeitrag einbehalten. Und fast jeder Häuslbauer, Käufer oder Mieter einer Neubauwohnung bekommt auch etwas davon zurück: An die 80 Prozent des heimischen Wohnbaus werden durch Wohnbauförderung kofinanziert, hinzu kommen Subventionen für die Sanierung von Altbauten. Damit hat sich diese Sozialleistung längst zu einer Mittelstandsförderung entwickelt – was, solange der Staat es sich leisten kann, keineswegs als Verschwendung zu werten ist: Der hohe Anteil an geförderten Wohnungen wirkt vor allem in den Ballungsräumen dämpfend auf das Wohnungspreisniveau, sodass das Leben in den Zentren hierzulande nach wie vor günstiger ist als in vergleichbaren Ländern – wo ein freier Wohnungsmarkt herrscht, der auch Durchschnittsverdiener vor Leistbarkeitsprobleme stellt.
So erhielten die Landesfürsten mit der vehement geforderten Verlagerung der Wohnbauförderung vom Bund auf die Länder Ende der Achtzigerjahre ein populäres Instrument, um sich als Unterstützer junger Familien, als Garanten erschwinglichen Wohnens und als Förderer des Jobmotors Bauwirtschaft zu profilieren. Doch konnten manche der Versuchung nicht widerstehen, die ihnen ebenfalls zugefallenen Forderungen gegenüber den Darlehensnehmern zur kurzfristigen Budgetsanierung zu verkaufen, auf dass ihnen die Rückflüsse fortan nicht mehr zur Verfügung standen. Zweifelhafte Bekanntheit erlangte damit vor allem das Land Niederösterreich, das 2002 langfristig fällige Wohnbaudarlehen in Höhe von sieben Milliarden Euro um 4,4 Milliarden Euro veräußerte und den Verkaufserlös am internationalen Kapitalmarkt veranlagte – beziehungsweise verspekulierte, wie ein Rechnungshofbericht von 2010 ergab.
Politischer Missbrauch
Im Zuge des Finanzausgleichs 2008 erwirkten die Länder schließlich auch noch die schon jahrelang forcierte Aufhebung der Zweckbindung der Wohnbauförderung – sprich es steht ihnen seither völlig frei, wofür sie die im Namen des sozialen Wohnbaus eingenommenen Steuergelder ausgeben. So finden heute bei weitem nicht mehr alle Fördermittel, die der Bund den Ländern überweist – knapp 900 Millionen Euro per anno aus der Lohnbesteuerung und in etwa dieselbe Summe aus weiteren Bundeszuschüssen – tatsächlich auch im Wohnbau Verwendung, ganz zu schweigen von den stetig sinkenden Rückflüssen aus bereits vergebenen Wohnbaudarlehen.
Umweltkontraproduktiv
Noch schwerer als diese finanzpolitische Willkür wiegt die siedlungspolitische Verantwortungslosigkeit, mit der die insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro pro Jahr eingesetzt werden. Mangels Koppelung an städtebauliche, raumplanerische und verkehrspolitische Ziele hat die Wohnbauförderung in den vergangenen vier Jahrzehnten massiv zur Suburbanisierung unserer Städte beziehungsweise zur Zersiedlung unserer Kulturlandschaft beigetragen. Während für ihre Vergabe inzwischen strenge Auflagen hinsichtlich der Heiz- und Haushaltsenergieeffizienz eines Hauses bestehen, spielen Bodenverbrauch, Standorteignung oder Erschließungsqualität nach wie vor kaum eine Rolle. Dabei kann ein noch so gut gedämmtes Haus mit fortschrittlichster Haustechnik niemals jene Energie einsparen, die bei Abhängigkeit des Wohnstandorts von einem Auto für die Mobilität der Bewohner aufgewendet wird – und erst recht nicht, wenn ein Haushalt zwei oder drei Pkws benötigt. Insofern verwundert es nicht, dass wissenschaftliche Studien die gegenwärtige Wohnbauförderung als „umweltkontrapoduktiv” einstufen.
Denn die Wohnbaupolitik unterscheidet kaum zwischen einem freistehenden Einfamilienhaus auf 1.000 Quadratmetern Grund, fernab jeglicher Infrastruktur, und einem Reihenhaus auf 250 Quadratmetern in zentraler Lage. Die einzige nennenswerte Ausnahme stellt hier das Land Tirol dar, dessen Wohnbauförderung angesichts der topografisch bedingten Baulandknappheit auf eine bodensparende Siedlungsentwicklung abzielt und verdichtete Bauweisen auf Grundstücken von maximal 400 Quadratmetern belohnt: Während die herkömmliche Eigenheimförderung je nach Haushhaltsgröße bei 21.000 bis 34.000 Euro liegt, kann das Förderdarlehen bei Verbauung einer Parzelle von nur 200 Quadratmetern bis zu 123.000 Euro betragen.
Schadensfall Einfamilienhaus
Längst dürften freistehende Einfamilienhäuser überhaupt nicht mehr gefördert werden, zumal es sich hierbei – allein schon wegen der enormen öffentlichen Erschließungs- und Erhaltungskosten für Straße, Wasser und Kanal – um die volkswirtschaftlich teuerste Siedlungsform handelt, die ohnehin auf meist billigem Grund entsteht. Jede weitere Subvention verstärkt die finanzielle Bevorzugung solch ineffizienter Verbauung der Peripherie nur noch weiter gegenüber einer kompakten Bebauung der Zentren. Und auch in sozialer Hinsicht ist das Häuschen im Grünen alles andere als nachhaltig: Sogenannte Scheidungshäuser, die für keinen der beiden getrennten Ehepartner mehr leistbar sind, offenbaren die zeitliche Beschränktheit des Glücks in dieser Wohnform ebenso wie zigtausende alte Menschen, die – alleinstehend – nicht nur mit der Instandhaltung eines ganzes Hauses überfordert sind, sondern vor allem auch darin vereinsamen.
Nachhaltige Förderziele
Dass eine Fokussierung der Wohnbauförderung auf verdichtete Bauformen und zentrale Standorte politisch sehr wohl durchzusetzen ist, zeigen ausländische Beispiele: In Deutschland versucht Nordrhein-Westfalen die Wohnbautätigkeit in den Großstädten zu konzentrieren und sieht in seinem Wohnraumförderungsprogramm zusätzlich zur Grundförderung von 20.000 bis 45.000 Euro einen „Stadtbonus” in der Höhe von weiteren 20.000 Euro vor, wenn Wohnraum in einer der 32 größten Städte des Landes geschaffen wird. Darüber hinaus genießt die Sanierung von Wohnungsbestand Vorrang gegenüber dem Wohnungsneubau. Ersatzlos abgeschafft wurde
in Deutschland die Eigenheimförderung des Bundes, eine Möglichkeit zur Steuerabschreibung beim Erwerb von neuem Wohnungseigentum.
Freilich steht es auch im städtischen Raum nicht immer zum Besten um die Förderpolitik. So sind in Wien die unsäglichsten Wohnbau- und Stadtentwicklungsprojekte der vergangenen zwei Jahrzehnte maßgeblich durch Wohnbaufördermittel mit ermöglicht worden: sei es die Wienerberg City oder Monte Laa, sei es die Gasomter City oder der Wohnpark Alte Donau – und darüber hinaus noch dutzende banale, monofunktionale Wohnquartiere, insbesondere in den großen Stadterweiterungsgebieten. Dies zeigt, dass es für die Vergabe der Fördermittel deutliche bessere Qualifizierungsinstrumente braucht, als dies bisher der Fall war – sprich Kriterien, die auf einen vollwertigen Wohn-, ja Lebensraum in urbanen, zukunftstauglichen Stadt- und Siedlungsstrukturen abzielen.
Neues Politikverständnis
Im Sinne der sozialen Treffsicherheit der Wohnbauförderung wäre zu klären, ob im städtischen Wohnbau auch weiterhin Eigentumswohnungen subventioniert oder die immer knapper werdenden Gelder auf den Bau von Miet- und Genossenschaftswohnungen konzentriert werden sollten. Ebenso denkbar wäre es, die Förderung auf gemeinnützige Wohnbaugesellschaften sowie Baugruppen zu beschränken – und gewerbliche, gewinnorientierte Bauträger auf den freien Markt zu entlassen. Gleichzeitig müssten die Ziele der Wohnbaupolitik mit jenen der Stadtplanungs- und Verkehrspolitik akkordiert werden, zumal der Wohnbau der Motor der Stadtentwicklung ist – und nur eine nachhaltige Stadtentwicklung hohe Wohn- und Lebensqualität in den Ballungsgebieten ermöglicht.
Wie groß die Widerstände gegen eine zukunftsorientierte Wohnbauförderung jedoch sind, zeigt allein das bisherige Scheitern aller Forderungen, die Zweckbindung der Fördermittel wiederherzustellen. Was Architekten-, Wirtschafts- und Arbeiterkammer, Gewerkschaften, Wohnbauträger und Bausparkassen seit Jahren unisono verlangen, hat nun sogar die neue Bundesregierung in ihr Arbeitsübereinkommen aufgenommen. Doch dürfen wir gespannt bleiben, ob die Platzhirsche des österreichischen Provinzialismus dies so ohne weiteres hinnehmen.