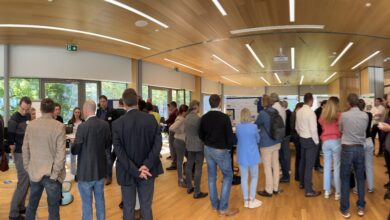Aglaée Degros: Als Gastgeberin einladen, Wissen zu teilen
Professorin Aglaée Degros ist seit 2016 Leiterin des Instituts für Städtebau an der Technischen Universität Graz und Science Fellow der Vrije Universiteit Brüssel. Ursprünglich in der belgischen Büro- und Planungspraxis verankert vertritt sie eine differenzierte und praxisorientierte Perspektive auf regionale Entwicklungen, auch in Österreich und im Vergleich mit anderen Regionen in Europa. Im akademischen Kontext versteht sie sich als neugierige Gastgeberin, die Wissen entdeckt, verdichtet und an andere weitergibt. Im Gespräch geht sie auf territoriale Gerechtigkeit und die stattfindende digitale Transformation ländlicher Regionen ein. Claudia Gerhäusser im Gespräch mit Aglaée Degros

Frau Degros, schon einmal gedacht „Wäre ich bloß keine Professorin für Städtebau geworden“?
Aglaée Degros: Ich habe lange nicht gedacht, dass ich Professorin werde. Jetzt sehe ich mich hauptsächlich als eine Gastgeberin, die selbst nicht alles weiß, aber andere dazu einlädt zu teilen, was sie wissen. Ich entdecke immer mehr, was mit dieser Professur möglich ist und welche Chancen sich etwa in der Verbindung von akademischem und planerischem Umfeld bieten.
Wie sieht das in Bezug auf ihre Disziplin konkret in Österreich aus?
Es gibt hier wenig Arroganz gegenüber der Provinz. Das kenne ich aus anderen Ländern und Regionen nicht. Das ist ein entschiedener Vorteil für reale und sozial-räumliche Gerechtigkeit – für territorial justice – die notwendige, aktuell stark gefährdete Balance zwischen Stadt und Land. Meines Erachtens ist es deshalb entscheidend, wie man Raum mit weiteren Systemen wie Ökologie oder Ökonomie zusammenbringen kann. In Österreich arbeitet die Raumplanung versus Urban Design (Städtebau). Ich suche nach einem alternativen Blickwinkel, in dem die Zwischenräume der Gebäude wichtig sind, da in ihnen verschiedene Systeme wie zum Beispiel Raum und Mobilität aufeinandertreffen.
Wie reagieren die Studierenden auf diese Perspektive?
Für die Studierenden hier am Institut ist das Thema Städtebau ganz neu. Sie müssen dessen Komplexität erst einmal entdecken, da sie bis dahin immer von einzelnen Gebäuden ausgegangen sind. In den Bachelor-Kursen vermitteln wir dennoch auch die klassische Idee des Städtebaus, sodass die Studierenden lernen, dass das Gebäude als Objekt immer einen Einfluss auf seinen Kontext hat und umgekehrt, aber dann kommt der Gedanke der sich überlagernden Systeme hinzu. Systeme der Infrastruktur, der Energieproduktion und der Ökologie, aber auch ökonomische und soziale Systeme werden thematisiert. Im Master ist die Herausforderung, letztlich die Komplexität im Städtebau anhand konkreter Projekte und realer Situationen zu gestalten. Studierende nehmen oft erst einmal das, was sie sehen, als Problem wahr. Das ist aber nur die Oberfläche und in der Architektur sogar nur die gebaute Oberfläche. Die Probleme liegen woanders. Aktuell entwerfen die Studierenden Fahrrad-Highways, die quer durch Graz dem Fahrrad stärkere Aufmerksamkeit im Verkehrsraum verschaffen und ihm Priorität geben.
Auf den ersten Blick hört sich das nach einer kleinen Aufgabe an, einen Fahrradweg zu entwerfen. Was heißt hier Highway, was entwerfen Sie mit den Studierenden genau?
Verkehrsräume sind öffentliche Räume. Das heißt, dass wir den Verkehrsraum als öffentlichen Raum umorganisieren und gestalterisch verändern, sodass eine kontinuierliche Mobilität für Radfahrer, in diesem Fall in Graz, möglich wird. Auf den geeigneten Strecken gibt es attraktive Räume, die durch den Fahrradhighway aktiviert werden können – Parkgrundstücke oder stillgelegte Gleise. Der Entwurf bezieht sich auf die gesamte Strecke und gestaltet den Raum – von Fassade zu Fassade. Nicht das Eigentum bildet die Grenzen, sondern die reale räumliche Situation. Die Infrastrukturräume werden anders interpretiert, so dass auch sozio-ökonomische und ökologische Einflüsse sichtbar werden.
Werden diese Entwürfe gemeinsam mit den Studierenden Politikern und Planungsämtern vorgestellt?
Ja, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit. In Graz ist das zum Beispiel das Mobility Lab, ein Konsortium städtischer Abteilungen, das sich mit dem Thema der Mobilität auseinandersetzt. Außerdem lade ich zu den Präsentationen am Ende eines Semesters internationale Planer und Persönlichkeiten ein, die einen überregionalen Diskurs mit den Studierenden und dem Institut führen. Am Institut geht es viel um die Analyse regionaler Situationen. Wir suchen nach Verbesserungspotenzial für die Nutzung der mobilen Infrastrukturen etwa von Regionalbahnhöfen. Teils ist die Taktung der Züge nicht auf die Arbeitszeiten ortsansässiger Betriebe oder auf spezifische Ortsbedingungen abgestimmt. An diesen Stellen entsteht die Arbeit mit Planern, Forschern und Studierenden gemeinsam. Ich möchte damit die bewusste Gestaltung des regionalen Maßstabs vorantreiben.
Räumliche Gerechtigkeit, „territorial justice“, ist der Titel der 2019 erscheinenden Ausgabe des Grazer Architektur Magazins, GAM#15, welches Sie redaktionell betreuen. Was hat es damit auf sich? Woher kommt dieses Thema?
Ich habe vielen Menschen zugehört. Mir schien, dass die Gestaltung regionaler Bezüge in der Steiermark eher schwach entwickelt ist. Der Städtebau wird oft über die Ökonomie entschieden. Dabei vergisst man die Regionen, in denen wenig oder keine ökonomische Dynamik entsteht. Vieles dreht sich um die Stadt aus diesem Grund, während das Umland vernachlässigt wird. Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatten klare Vorstellungen dazu, was die Stadt ist und sein kann, aber die Peripherie und den ruralen Raum betrachteten sie als eine wenig komplexe Produktionslandschaft, als sei diese nicht bewohnt. Das ist schade. Zwar leben statistisch gesehen über 50 Prozent der Menschen in der Stadt, aber es gibt die anderen 50 Prozent, die in der Region leben eben auch noch. Es gibt viele Fragen dazu, viele leere Gebäude auf dem Land, Mobilitätsprobleme, Probleme in der Gesundheitsversorgung und im Bildungsangebot. Das Umland darf nicht als Produktionsort für die Städte missverstanden werden. Wo junge Menschen diese Orte verlassen, da entstehen Spekulationsflächen und letztlich wirklich nur noch Produktionsanlagen. In Zukunft heißt das mit fortschreitender Digitalisierung der Produktion leider nicht einmal mehr, dass dort Arbeitsplätze entstehen werden.
Was können akademische Kontexte wie die Universität oder auch das GAM in dieser Lage leisten?
Auf der Ebene der lokalen Politik verhindern Routinen oftmals alternative und visionärere Ansätze. Teils können städtebauliche Instrumente auch deshalb nicht verwendet werden. Universitäten und Forschungseinrichtungen müssen ihren Teil zur Unterstützung der Kollegen in kleinen Städten beitragen. Das Institut für Städtebau an der TU Graz hat gemeinsam mit den Planungsabteilungen der TU Wien und dem Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) ein Weiterbildungsprogramm entwickelt. Der Universitätskurs „Ideen und Impulse für smarte Quartiersentwicklung in Klein- und Mittelstädten“ richtet sich an die Verantwortlichen in den Verwaltungen und Planungsämtern kleinerer Städte und Ortschaften. In Workshops werden Themen und Probleme bearbeitet, die vorab von den potenziellen Teilnehmern aus der Praxis, den Stadtverwaltungen in Österreich, ZT Kammermitgliedern usw. eingebracht werden.
Und das GAM?
GAM#15 wird mit dem Thema „territorial justice“ den Fokus des akademischen Umfeldes auf praktische Probleme lenken. Da gibt es beispielsweise Nicolas Escach, Dozent der Geografie an der Sciences Po Rennes in Caen und an der Universität Lyon. Er schrieb in der Zeitschrift „le monde“ einen Artikel über Kopenhagen und dessen Umland. Die Stadt – ähnlich Graz – wächst. Gleichzeitig wird deren Umfeld weniger attraktiv. Er wird diesen Kontrast auch im GAM#15 thematisieren. Rem Koolhaas mit OMA arbeitet seit Jahren an dem Thema der Ruralität. Ergebnisse werden jetzt in einer Ausstellung in New York gezeigt. Demnach passieren die Entwicklungen letztlich viel schneller auf dem Land, im ruralen Kontext, als in den Städten. Digitalisierung ist dann kein urbanes Phänomen, sondern eine rurale Tatsache. Die Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit in einer solchen Transformation finden wir wiederum eher bei Bernardo Secchi.
Wie sieht diese Transformation räumlich aus – eine Digitalisierung des ländlichen Raums?
Das GAM#15 versammelt internationale Beiträge zu diesem interessanten Thema. So wird in Singapur Sand aus dem Umland für die Flächenerweiterung der Stadt benutzt. Das ist dramatisch für die Umgebung für deren Bewohner sich die Lebensgrundlage irreversibel verändert. Nicht nur die sozialen Ressourcen werden zwischen Land und Stadt ungerecht verteilt, sondern auch fundamentale physische Ressourcen werden von Städten wie Singapur vereinnahmt. Im ländlichen Raum verbleibt die Agrarindustrie. Was sich ändert ist die Art der Produktion. Man wird kaum noch Menschen in der landwirtschaftlichen Produktion brauchen, und das Land kann zum unbewohnten Territorium werden. Deshalb ist zum jetzigen Zeitpunkt das Thema der Gerechtigkeit so wichtig. Die Gesellschaft muss das existierende Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land, zwischen jungen und älteren Generationen, berücksichtigen. Klassisch stehen sich Dorf und Stadt immer noch gegenüber. Man hat sich zu entscheiden, ob man urban oder rural ist. Dabei könnte man die Idee der New Nomades aufgreifen und einzelne Lebensphasen in der Stadt, andere am Land verbringen. Für eine erfolgreiche Transformation, brauchen wir an beiden Orten Netzwerke. Das braucht Zeit und hält viele davon ab, aufs Land zu gehen. Das braucht Zeit und hält viele davon ab aufs Land zu gehen.
Nicht jeder wird sich auf dem Land oder auch in beiden Sphären halten können. Zudem scheint es schwierig, in bestehende Dorfgemeinschaften hineinzukommen. Soziale und ökonomische Strategien, aber auch eine Kultur der Solidarität wären entscheidend für eine territoriale Gerechtigkeit. Spielen sozialpolitische Modelle wie ein bedingungsloses Grundeinkommen bei dieser Transformation eine Rolle für Sie? Würde sich mit einer sozialen Gerechtigkeit auch eine territoriale herstellen lassen?
Vielleicht gibt es darauf keine einfache Antwort. Städtebau ist so stark an die Ökonomie gebunden. Er ist ein Spiegel der Sozialökonomie und funktioniert wie eine räumliche Übersetzung des bestehenden Systems. Die Ungerechtigkeit durch Digitalisierung wird wesentlich stärker werden. Es kann richtig unangenehm werden, wenn das System so bleibt, wie es ist. Dennoch gibt es interessante Ideen oder Projekte, die eine Diskussion über dieses Thema ermöglichen. Das niederländische Designerduo Arvid and Marie hat einen Roboter entworfen, der Soda macht. Sie haben ihm eine Steuernummer verschafft, haben ihm ein Bankkonto angelegt, und er sollte sein Business autark, unabhängig von ihnen als Autoren, betreiben. Er generiert seine eigene Ökonomie. Die Frage stellt sich demnach, woher wir in Zukunft Geld bekommen, wenn Technik und Ökonomie autonom funktionieren? Was passiert dann? Die Designer des Roboters schlagen vor, dass dieser ihnen eine Abgabe oder Profitbeteiligung zahlt, da sie ihn entworfen haben. In einer Zukunft in der man nichts mehr durch Arbeit in der Produktion verdient, kann man eventuell Geld durch Autorenschaft und kreative Leistung, durch Entwerfen, verdienen. Das ist sehr nah an unserer Disziplin und ist bis jetzt zu kurz gekommen. Im Städtebau wirken unterschiedliche Systeme ineinander. Ähnlich dem Roboter der zwei Designer gibt es auch hier Bestrebungen, einzelne Prozesse völlig autonom und menschen-unabhängig erst zu entwerfen und dann umzusetzen. Selbst wenn das jetzt noch als Vision gilt, stellt es dennoch unser ökonomisches System infrage und damit auch die aktuelle räumliche Ordnung. In der Veränderung der Ökonomie steckt ebenfalls eine Veränderung des Raumes. Ob das als Potenzial verstanden wird, liegt an uns.
Wenn wir das herrschende ökonomische System infrage stellen, was ist dann möglich?
Helsinki ist ein gutes Beispiel. Es steht auf der Liste der Städte mit hoher Lebensqualität weltweit ganz oben. Dabei ist es weder finanziell noch ökonomisch unter den besten Städten Europas. Die Lebensqualität wird durch andere Indikatoren gemessen, und die Politik gestaltet bewusst die Umverteilung von Vermögen und Besitz – durch steuerlich geförderten Wohnbau zum Beispiel, über 40 Prozent davon in Neubauten aus den letzten 20 Jahren. Wer die Hintergründe nicht kennt, kann meinen, dass es sich um Gentrifizierung handelt, was nicht der Fall ist. Sicherlich gibt es auch in Helsinki Zeichen einer sozialen wie räumlichen Ungerechtigkeit, aber in geringerem Ausmaß als es bei uns sichtbar ist.
Sind für Sie die Strategien aus Finnland auf andere Länder und Regionen übertragbar?
Im Prinzip ja. Finnland probiert vieles aus und evaluiert danach die Auswirkungen. In Österreich höre ich oftmals, dass das so hier nicht geht. Aber warum? Realistische Strategien sehen eher aus wie ein Krisenmanagement als der Vorschlag baulicher Maßnahmen. Dazu käme die langfristige Evaluierung der Strategien auf vielen Ebenen. Man müsste zwei, fünf, zehn Jahre später die Auswirkungen analysieren und sich fragen, was passiert mit dem Verhalten der Menschen, mit den Ökosystemen und dem Raum, welche Dinge konnte man beeinflussen? In Graz gibt es viele Smart-City-Pilotprojekte. Jetzt wäre es an der Zeit, diese zu evaluieren. Aber es ist unglaublich schwer für diese Evaluierungen an das nötige Geld zu kommen. Man hat die Idee die Projekte seien fertig. Viele, auch Architekten und Studierende, scheinen sich weniger mit aktuellen Aspekten in ihrer direkten Umgebung auseinander zusetzen. Da gibt es die Feststellung, dass immer mehr Menschen in Graz alleine sind. Hier wäre es möglich, sich einen Raum zur Beobachtung zu suchen, dort etwas zu verändern und diese Eingriffe aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten. Raum geht weit über den physischen, gebauten Raum hinaus. In Brüssel ist der Städtebau eng mit den Instituten der Geografie verbunden, während in Wien die Raumplaner und Städtebauer intensiv mit Soziologen zusammenarbeiten. Die Medizinische Universität hat mich gefragt, wo es Partner gibt, mit denen man öffentliche Räume so umgestalten kann, dass ältere Menschen möglichst lange selbstständig mobil bleiben können. In der Forschung sieht es da besser aus als in der architektonischen Praxis.
Wenn Sie zwei Jahre in die Zukunft schauen: Wie stellen Sie sich die Aufgaben und Verantwortung des Städtebaus vor? Was, wenn Sie 200 Jahre vorausdenken?
Ich kann nicht sagen, ob es meine Disziplin in 200 Jahren noch geben wird, oder wie wir leben werden, wie die Welt dann aussehen wird. Ich habe vor drei Jahren nicht einmal gewusst, dass ich Professorin werde. Es ist eine interessante Frage, was 200 Jahre verändern, was in einer solchen Zeit verloren gehen, aber auch gewonnen werden kann. Dass es die Universität dann noch gibt – als Raum, in dem sich kritisches Denken entwickeln lässt, wäre mindestens zu wünschen.
AGLAÉE DEGROS, geb. 1972 in Leuven, Belgien.
Professorin und Leiterin des Instituts für Städtebau an der TU Graz und der Science Fellow der Freien Universität Brüssel.
Studium der Architektur in Brüssel, Karlsruhe und Tampere. 2001 gründete sie gemeinsam mit Stefan Bendiks in Rotterdam „Artgineering“, ein Büro das sich der Aufgabe widmet, die Beziehung zwischen Landschaft, Stadt und Infrastruktur zu verbessern;
2014 Übersiedlung nach Brüssel.
Verschiedene Lehraufträge und Gastprofessuren u. a. an der TU Delft, Rotterdam Academy of Architecture, Freie Universität Brüssel, Akademie der bildenden Künste Wien und der TU.
Degros ist Co-Herausgeberin von Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe (2013) und Co-Autorin von Brussels, [re]discovering its spaces (2014). Sie wird regelmäßig als Jurymitglied zu internationalen Städtebau- und Entwurfswettbewerben geladen.
“Das Umland darf nicht als Produktionsort für die Städte missverstanden werden.” – Aglaée Degros